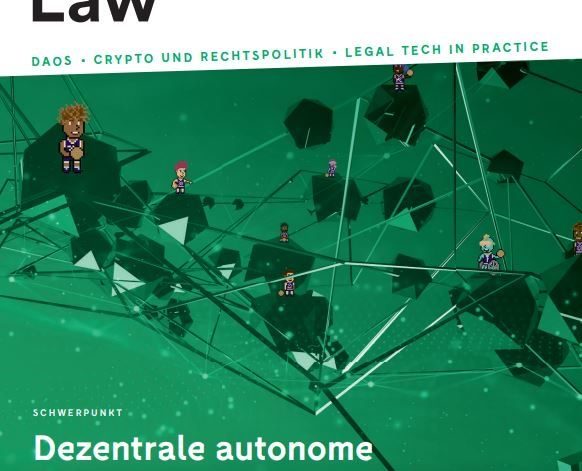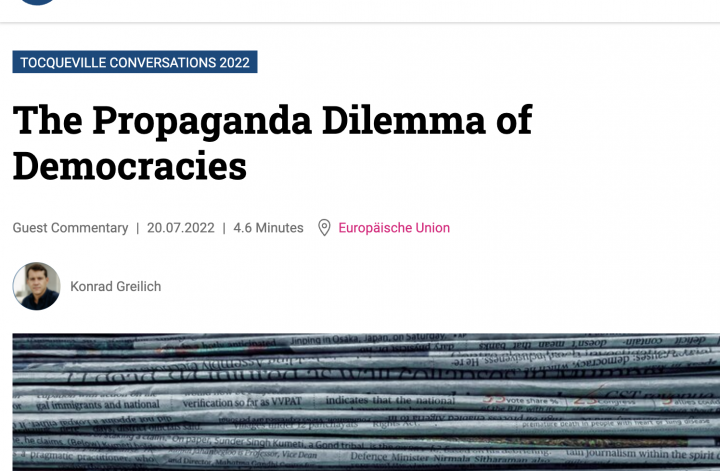In the last few months, I had the privilege of being the editor-in-chief of the focus issue of Rethinkinglaw on the topic of my heart and dissertation, DAOs. Now the issue is finally finished and I am really a little bit proud of the result.
My goal was to give the general legal public a deep insight into how this new form of organization works, to present actual use cases, and not just to address the often abstract legal problems. Thanks to excellent contributions by Markus Büch, Kai Kremer, Dr. Biyan Mienert and Florian Glatz, among others, I believe this has been achieved.
By the way, readers will also learn from Benjamin Strasser what the German government is planning to digitize corporate law and get an incredibly exciting insight into the work of a crypto lawyer in an interview with Silke Noa.
On the cover you see numerous Jerrys trying to buy an NBA team together. What exactly Jerrys are and why they want to buy an NBA team, you can read in the interview with KrauseHouse creator Commodore.
The Magazin is available at your trusted Magazine retailer or online.